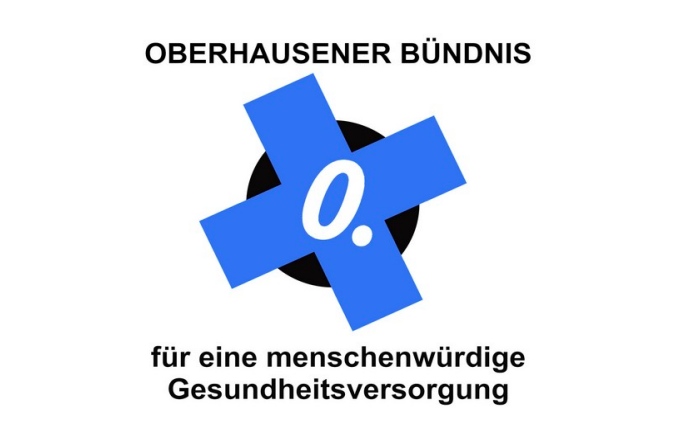Ein Artikel vom Oberhausener Bündnis für eine menschenwürdige Gesundheitsversorgung
Seit einem Jahr beschäftigen wir, das Oberhausener Bündnis für eine menschenwürdige Gesundheitsversorgung, uns intensiv mit dem Thema „ambulante Versorgung“: Uns beschäftigt die Frage, wie künftig die ambulante Gesundheitsversorgung in Oberhausen sichergestellt und verbessert werden kann.
Diese Frage stellt sich aktuell aus mehreren Gründen:
Im Zuge der neuen Krankenhausplanung sollen stationäre Betten abgebaut und Behandlungen in den ambulanten Bereich verlagert werden. Doch schon in den letzten Jahren wurden (nicht nur) in Oberhausen und der näheren Umgebung bereits einzelne Stationen oder ganze Krankenhäuser geschlossen.
So ist mit der Übernahme des KKO durch AMEOS im Jahr 2019 bereits das Joseph-Hospital in Oberhausen-Mitte als Allgemeinkrankenhaus weggefallen. Es gibt dort nur noch die Psychiatrie. Und AMEOS hat im Marienhospital in Osterfeld seitdem eine Abteilung nach der anderen geschlossen.
Nun ist das Marienhospital bei der Vergabe von Leistungsgruppen im Rahmen der Krankenhausplanung leer ausgegangen – und damit ist es als stationärer Versorger komplett weggefallen.
Das ist voraussichtlich nur der Anfang – denn diese Entwicklung ist politisch gewollt.
Der Bedarf an ambulanten Einrichtungen ist also bereits erheblich und wird absehbar weiter wachsen. Doch schauen wir uns um in unserer Stadt, so stellen wir fest:
Bereits heute gibt es Mängel und Lücken in der ambulanten Versorgung. Und ein Ausbau ambulanter Einrichtungen ist nicht geplant. Im Gegenteil zeichnet sich eine ärztliche Unterversorgung in Oberhausen ab, wenn hier nicht gegengesteuert wird:
Stand 01.01.2024 waren 56 der 123 praktizierenden Hausärzt*innen über sechzig Jahre alt. Nur 36 Hausärzt*innen – also gerade einmal 20,3 % – sind fünfundvierzig oder jünger. Bei der fachärztlichen Versorgung sieht es ähnlich aus.
Wohin sollen wir also in Zukunft gehen, wo es doch heute schon zu lange Wartezeiten für (Fach-)Arzttermine, in Praxen und Ambulanzen gibt? Und die Wege für die Behandlung immer länger werden?
„Gut versorgt in Oberhausen?“
Wir organisierten im Juni 2024 zusammen mit ver.di Ruhr-West eine Podiumsdiskussion „Gut versorgt in Oberhausen?“ mit Vertreter*innen aus Politik und Verwaltung auf der einen und Beschäftigten und Nutzer*innen von Gesundheitseinrichtungen auf der anderen Seite. Im Januar 2025 diskutierten wir mit interessierten Bürger*innen über die gleichen Fragen.
Ein Ergebnis der Diskussion im Januar war, dass Anlaufstellen mit Notfallversorgung und Ärzt*innen der wichtigsten Fachrichtungen, die wohnortnah, niedrigschwellig und rund um die Uhr erreichbar sind, die Versorgungslage deutlich verbessern würden.
In diesem Zusammenhang fällt in letzter Zeit immer wieder das Stichwort „Polikliniken“. Können solche multiprofessionellen Stadtteil-Gesundheitszentren auch ein Modell der Zukunft für unsere ambulante Gesundheitsversorgung in Oberhausen sein?
Polikliniken ‒ Modell der Zukunft?
Am 30. Juni 2025 führten wir, unterstützt vom Verein zur Förderung eines solidarischen und öffentlichen Gesundheitswesens NRW e.V., eine dritte Veranstaltung durch, um uns mit diesem Konzept auseinanderzusetzen.
Hierzu hatten wir Katharina Schwabedissen, Gewerkschaftssekretärin Fachbereich Gesundheit, Soziales, Bildung und Wissenschaft ver.di Ruhr West und Jens Eyding von Bochum Gesund und Solidarisch e.V. eingeladen.
Zu Beginn stellte Petra Stanius das Oberhausener Bündnis und die Intention der Veranstaltung vor.
Dann versorgte Katharina Schwabedissen die Teilnehmenden mit dem nötigen Hintergrundwissen. Sie erläuterte mit ihrem ausführlichen und anschaulichen Beitrag, warum die Verlagerung von Behandlungen in den ambulanten Bereich die Tür für Polikliniken vor Ort öffnen könnte. Und warum es trotz aller ihrer Vorteile starke politische Widerstände gegen die Einrichtung von Polikliniken gibt.
Um dies verständlich zu machen, musste sie weit ausholen: Denn die strukturellen Veränderungen bei der stationären Versorgung seit den 1970er Jahren spielen in dem Zusammenhang eine bedeutende Rolle.
Krankenhäuser: von der Daseinsvorsorge zur Fabrik
Über mehrere Jahrzehnte wurden Krankenhäuser als Aufgabe der Daseinsvorsorge behandelt, für deren Erfüllung letztlich der Staat verantwortlich war. Was sie hierfür an Ressourcen benötigen, wurde den Kliniken nach dem Selbstkostendeckungsprinzip vollständig finanziert. Das Erzielen von Gewinnen war verboten.
In den 1980er und 1990er Jahren kam die Erzählung von der angeblichen Kostenexplosion im Gesundheitswesen auf – die längst widerlegt ist. Begleitet wurde sie von der Behauptung, dass „Privat“ alles besser und billiger kann als „Staat“.
DieFinanzierung der Krankenhäuser wurde auf Fallpauschalen (DRG) umgestellt, Profite durch Therapien wurden möglich. Damit wurden Kliniken für gewinnorientierte private Investoren interessant. Seitdem werden Krankenhäuser als Unternehmen geführt, die in erster Linie der Erwirtschaftung von Profiten verpflichtet sind.
Die heute hinlänglich bekannte und beklagte Unterfinanzierung von Krankenhäusern ist also politisch entschieden worden. Wobei „Unterfinanzierung“ nicht bedeutet, dass Krankenhäuser insgesamt dadurch weniger Geld kosten. Im Gegenteil, das deutsche Gesundheitswesen ist im internationalen Vergleich teuer – ohne dass die Versorgung durchgehend eine entsprechend hohe Qualität hätte.
Auch zur Zeit des Selbstkostendeckungsprinzips wurden Mittel fehlverwendet – aber das System der Fallpauschalen belohnt faktisch die Fehlverwendung. Sichtbar wird dies unter anderem mit der ungewöhnlich hohen Zahl an (lukrativen) Knie-Operationen und mit der Ausschüttung unserer Krankenkassenbeiträge an die Anteilseigner von privaten Kliniken.
Aber nicht nur private Klinikbetreiber folgen der ökonomischen Logik. Systembedingt sind ihr auch die Krankenhäuser in öffentlicher Hand oder von freigemeinnützigen Trägern unterworfen.
Diese Logik hat die Zahl überflüssiger Operationen in die Höhe getrieben, zu unverantwortlichem Personalabbau bei der Pflege geführt, Reinigungs- und Servicekräfte zu miesen Arbeitsbedingungen ausgegliedert, einst leistungsfähige Krankenhäuser ruiniert…
Es braucht eine Rückbesinnung darauf, was Krankenhäuser eigentlich sind: Nämlich, siehe oben, eine Aufgabe der öffentlichen Daseinsvorsorge.
Wohin geht die Reise im ambulanten Bereich?
Derzeit besteht die Gefahr, dass trotz der negativen Erfahrungen mit der Ökonomisierung der Krankenhäuser eine ganz ähnliche Entwicklung im ambulanten Bereich folgt.
Der wachsende ambulante Sektor droht ein neues Feld für die Betätigung profitorientierter Konzerne und Investoren zu werden, auch, weil die Gewinnaussichten im stationären Bereich sinken.
Um die weitere Zerstörung der stationären Versorgung zu stoppen und eine vergleichbare Ökonomisierung der ambulanten Versorgung gar nicht erst zuzulassen, braucht es ein Gewinnverbot für Krankenhäuser und medizinische Versorgungszentren (MVZ).
Die sinkende Zahl niedergelassener Ärzt*innen zeigt, dass das Kleinunternehmen „eigene Arztpraxis“ ein Modell der Vergangenheit ist. Im MVZ arbeiten auch die Ärzt*innen als Angestellte – mit geregelten Arbeitszeiten und ohne das Risiko der Überschuldung. Die Anzahl von MVZ nimmt stetig zu.
Als Betreiber der MVZ sind nicht zuletzt die Kommunen gefragt. Finanziert werden sollen die Einrichtungen bedarfsgerecht nach dem Selbstkostendeckungsprinzip.
Es geht dabei nicht darum, dass mehr Geld ins System fließen soll, sondern um die Verwendung des eingeplanten Geldes für eine gute Gesundheitsversorgung. Und diese richtet sich nach dem Bedarf. Was brauchen wir an Gesundheitsleistungen und -einrichtungen? Dieser Bedarf muss zunächst einmal in einem demokratischen Prozess ermittelt werden.
Mit entsprechender Ausstattung der Einrichtungen sind auch Behandlungen ambulant möglich, die heute stationär erfolgen. Zu wenig Mittel fließen heute in die Prävention oder in die Unterstützung in schwierigen Lebenslagen.
Die starre Trennung von stationärem und ambulantem Sektor verhindert ein ganzheitliches Konzept – und damit eine optimale Versorgung. Für eine gute Versorgung sind unterschiedliche, auch nichtärztliche Berufsgruppen gefragt.
Polikliniken bieten eine niederschwellige, ganzheitliche, interdiszipinäre Versorgung, wo verschiedene Berufsgruppen vernetzt arbeiten, und die Prävention im Vordergrund steht. Solche Gesundheitszentren, betrieben z.B. von Kommunen oder nicht-profitorientierten Vereinen, in jedem Stadtteil, wären genau die Einrichtungen, die wir für den Ausbau der ambulanten Versorgung bräuchten.
Es gibt nichts Gutes, außer…
Katharina Schwabedissen machte jedoch wenig Hoffnung, dass das politische Handeln sich in diese Richtung bewegen wird. Im Gegenteil: Der Koalitionsvertrag von CDU und SPD setzt auf das Primärarztsystem – ungeachtet des bekannten Mangels an Hausärzt*innen. Ärztliche und nichtärztliche Berufsgruppen sollen nicht auf der Grundlage ihrer jeweiligen Kenntnisse und Fähigkeiten auf Augenhöhe kooperieren. Stattdessen wird von der Politik ein arztorientiertes, sehr hierarchisches System der Zusammenarbeit angestrebt. Auch von guten Beispielen, unter anderem aus der eigenen Vergangenheit, wollen die verantwortlichen Politiker*innen offenkundig nichts lernen.
Das Fazit der Referentin:
Wir müssen es selber machen! – die Gesundheitsbündnisse, das Poliklinik-Syndikat…
An diesem Punkt setzte Jens Eyding an mit einem praktischen Beispiel:
Er berichtete von seiner Gruppe, die sich für ein solidarisches und am Gemeinwohl orientiertes Gesundheitssystem im Bochumer Osten einsetzt. Hierfür haben die Beteiligten im Dezember 2024 einen Verein gegründet: Bochum Gesund und Solidarisch – BoGeSo e.V. (siehe https://bogeso.de).
Es geht ihnen um die Errichtung eines Stadtteilgesundheitszentrums, das im oben beschriebenen Sinne arbeitet. Dabei ist es den Beteiligten wichtig, selbst etwas umsetzen zu können. Einige haben z.B. als Ärzt*innen medizinische Kenntnisse, aber niemand von ihnen verfügt über über Immobilien oder sonstige nennenswerte finanzielle Mittel. Sie können also nicht selbst dieses Zentrum schaffen. Sie wollen aber auch nicht warten, bis irgendwann einmal ein komplettes Projekt steht.
Im LutherLAB in Bochum-Langendreer lädt BoGeSo die Anwohner*innen zu medizinischen Vorträgen ein, um deren Gesundheitskompetenz zu fördern. Der Verein will durch öffentliche Diskussion die gesundheitliche Selbstbestimmung der Menschen stärken, Solidarität fördern und zu eigenen Aktivitäten ermuntern.
Denn, davon ist Jens Eyding, überzeugt, wenn sich die Bürger*innen bewegen, dann bewegt sich auch die Politik.
Dachverband der Solidarischen Gesundheitszentren in Deutschland ist das Poliklinik-Syndikat (siehe https://www.poliklinik-syndikat.org/)
Ein Problem aller Gruppen, die sich im bzw. im Sinne vom Poliklinik-Syndikat engagieren, ist die Finanzierung ihrer Projekte. Ihr Anspruch ist, Kommunen und die Kassenärztliche Vereinigung hier einzubeziehen. Und das ist schwierig. In der Politik ist es unstrittig, dass das System der Fallpauschalen (DRG) geändert werden muss. Aber die betroffenen Stände wehren sich dagegen, Geld und Status zu verlieren.
Ein fertiges Konzept für ein solidarisches Gesundheitszentrum, das für jeden Ort passt, gibt es nicht. Aber es gibt ganz unterschiedliche Versuche, solche Zentren zu schaffen.
Der Referent erwähnt als interessantes Projekt das Gesundheitszentrum St. Vincenz in Essen-Stoppenberg: Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hält es für zukunftsträchtig und fördert es für zwei Jahre. Danach erscheint die weitere Finanzierung über Tagespauschalen politisch möglich. Die Stadt Essen ist mit 49 % an St. Vincenz beteiligt – ein Schritt in die richtige Richtung.
Wenn im Bochumer Osten ein MVZ entsteht, wäre der Verein gerne als beratendes Mitglied dabei. Der nächste Schritt von BoGeSo ist, mit den Bochumer Ratsfraktionen ins Gespräch zu kommen.
Was tun?
Bei der anschließenden Diskussion berichteten Teilnehmer*innen aus Mülheim und Duisburg, das dort in (ehemaligen) Einkaufszentren investorengesteuerte MVZ eingerichtet wurden – mit Blick vor allem auf eine zahlungskräftige Kundschaft.
In Geldern sei ein kommunales Gesundheitszentrum eingerichtet worden. Sofort hätten zahlreiche Mediziner*innen sich beworben. Das Argument, für das im Vergleich zum Honorar niedrige Gehalt wären Ärztestellen nicht zu besetzen, träfe also nicht zu.
Eine Teilnehmerin ärgerte sich darüber, dass Vertreter*innen von Rat und Verwaltung der Stadt Oberhausen Probleme wie den Hausärztemangel und überlange Wartezeiten kleinredeten bzw. darauf gar nicht eingingen. Und nach außen vermittelten, dass alles in bester Ordnung sei.
Dabei musste die Stadt Oberhausen jüngst die geplanten hundert öffentlichen Wasserspender auf zehn reduzieren: Gesundheitsgefährdung der Bevölkerung durch sommerliche Hitze hin oder her – für die Prävention fehlt das Geld.
Wirklich keine gute Idee, sich auf die Politik zu verlassen, wenn es um unsere Gesundheit geht. Ohne Druck von unten passiert nichts – egal, wer da gerade am Drücker sitzt.
Mit der Schließung des Marienhospitals hat sich das Angebot medizinischer Leistungen in Oberhausen-Osterfeld deutlich verschlechtert.
Was brauchen die Menschen dort, um gut versorgt zu sein?
Vielleicht eine Poliklinik im ehemaligen Marienhospital, solidarisch und am Gemeinwohl orientiert – ohne Profite für AMEOS?
Wir können sie fragen.
von Petra Stanius, Oberhausener Bündnis für eine menschenwürdige Gesundheitsversorgung
10. Juli 2025